Springe zu einem wichtigen Kapitel
Um die Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes besser kennenzulernen, kannst Du Dir diese Erklärung anschauen, die den Anwendungsbereich, den wichtigsten Inhalt und die Folgen von Verstößen gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz thematisiert.
Jugendarbeitsschutzgesetz zusammengefasst – Ziele & Vorschriften
Das Jugendarbeitsschutzgesetz kannst Du mit JArbSchG abkürzen. Es ist im Jahr 1960 in Kraft getreten und dient dem Schutz von jungen Menschen unter 18 Jahren im Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis. Es gehört zum Bereich des Arbeitsrechts, da es Belange, die im Kontext der Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen stehen, regelt.
Das Ziel des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist es, Jugendliche im Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis zu schützen. Dabei sollen die jungen Menschen vor
- einer Gefährdung ihrer Gesundheit
- Überforderung
- zu hoher Arbeitsbelastung
- einer Störung in ihrer Entwicklung
- einer Überbeanspruchung
- zu langen Arbeitszeiten
bewahren.
Die Jugendlichen sollen also davor geschützt werden, dass sie eine Beschäftigung ausführen, die sie körperlich und seelisch zu stark belasten. Sie sollen durch die Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis nicht in ihrer Entwicklung gestört werden, sondern darin unterstützt werden.
Zu den Regelungen, die das Gesetz zum Schutz der Jugendlichen trifft, gehören Vorschriften über:
- Verbot von Beschäftigung von Kindern
- Arbeitszeiten
- Urlaub
- Pausen
- Berufsschule
- Freizeit
- Gesundheitliche Betreuung
Das Gesetz muss immer dann Anwendung finden, wenn Jugendliche in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis angestellt sind. Deshalb muss es insbesondere im Bereich der Berufsausbildung angewendet werden, weil viele Auszubildende bei Beginn der Ausbildung minderjährig sind.
Der genaue Geltungsbereich des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist in § 1 JArbSchG geregelt.
Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone für die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,
in der Berufsausbildung,
als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,
mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern oder Heimarbeitern ähnlich sind,
in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis (§ 1 Abs. 1 JArbSchG).
Das Gesetz bezieht sich also auf junge Menschen, die unter 18 Jahre alt sind und in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis stehen.
Im § 2 JArbSchG wird genauer definiert, wer Kind und wer Jugendlicher im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist.
Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.
Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§ 2 Abs. 1, 2 JArbSchG).
Martin ist 18 Jahre alt und beginnt, nachdem er sein Abitur abgeschlossen hat, eine Ausbildung.
Anna ist gerade 17 Jahre alt geworden und beginnt ihre Ausbildung nach ihrem Realschulabschluss.
Frage: Sind Martin und Anna beide durch das Jugendarbeitsschutzgesetz geschützt?
Lösung:
Martin und Anna beginnen zwar beide eine Berufsausbildung. Allerdings ist Martin bereits 18 Jahre alt. Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt nur für Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind, § 1 Abs. 1 JArbSchG. Daher finden die Vorschriften des JArbSchG auf Martin keine Anwendung. Im Gegensatz dazu ist Anna noch keine 18 Jahre alt, sodass das JArbSchG anwendbar ist, § 1 Abs. 1 Nr. 1 JArbSchG.
Beschäftigung von Kindern
Ob die Beschäftigung von Kindern möglich ist, findest Du heraus, wenn Du Dir den § 5 ArbSchG näher ansiehst. Dort heißt es:
Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten (§ 5 Abs. 1 JArbSchG).
In § 5 Abs. 2 JArbSchG wird von diesem generellen Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 15 Jahren Ausnahmen genannt. Demnach ist eine Beschäftigung von Kindern
- zum Zweck der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 JArbSchG)
- im Rahmen eines Betriebspraktikums (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 JArbSchG)
- in Erfüllung einer richterlichen Weisung (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 JArbSchG)
möglich.
Das Verbot der Beschäftigung von Kindern findet gem. § 5 Abs. 3 S. 1 JArbSchG bei Kindern über 13 Jahren auch keine Anwendung, wenn
- die Erziehungsberechtigten der Beschäftigung zugestimmt haben
- und es sich um leichte Tätigkeiten handelt, die für Kinder geeignet sind
In welchen Fällen es sich um eine leichte Tätigkeit handelt, wird in § 5 Abs. 3 S. 2 JArbSchG festgelegt.
Eine Beschäftigung ist leicht, wenn sie
- die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder,
- ihren Schulbesuch, die Berufsausbildung oder die Berufswahlvorbereitung
- und ihre Fähigkeit dem Schulunterricht zu folgen
nicht nachteilig beeinflusst.
Außerdem dürfen Kinder zwischen 13 und 15 Jahren gem. § 5 Abs. 3 S. 3 JArbSchG nicht mehr als zwei Stunden täglich, nicht nachts und nicht vor und während des Schulunterrichts arbeiten.
Wichtig zu wissen ist weiterhin, dass die Vorschriften des § 5 JArbSchG auch bei Jugendlichen Anwendung finden, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, § 2 Abs. 3 JArbSchG.
Emelie ist 14 Jahre alt und möchte etwas Geld verdienen, weil sie auf ein neues Fahrrad spart. Sie plant, Zeitungen auszutragen, womit ihre Eltern einverstanden sind. Emelie fragt sich, ob das einmal die Woche an einem Mittwochnachmittag, an dem sie keine Schule hat, möglich ist.
Emelie ist 14 Jahre alt und damit gem. § 2 Abs. 1 JArbSchG ein Kind im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Grundsätzlich ist die Beschäftigung von Kindern gem. § 5 Abs. 1 JArbSchG verboten. Ausnahmsweise kann es für Kinder über 13 Jahren erlaubt sein, wenn ihre Erziehungsberechtigten zustimmen und es sich um eine leichte Beschäftigung handelt, § 5 Abs. 3 S. 1 JArbSchG. Die Eltern von Emelie haben zugestimmt, dass sie Zeitungen austrägt. Das Austragen von Zeitungen beeinflusst die Gesundheit, Sicherheit, Entwicklung, den Schulbesuch oder die Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen, in der Regel nicht negativ. Deshalb handelt es sich um eine leichte Tätigkeit. Emelie würde nicht mehr als zwei Stunden täglich und nicht nachts, vor oder während der Schulzeit arbeiten (§ 5 Abs. 3 S. 3 JArbSchG). Somit ist es möglich, dass sie Zeitungen austrägt, um Geld zu verdienen.
Jugendarbeitsschutzgesetz Übersicht
Damit Du Dich bei den Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes besser zurechtfinden kannst, gibt es hier diese Übersicht mit den wichtigsten Regelungen des JArbSchG:
Regelungsinhalt | Norm |
Allgemeine Vorschriften | §§ 1-4 JArbSchG |
Beschäftigung von Kindern | §§ 5-7 JArbSchG |
Beschäftigung Jugendlicher Arbeitszeit und Freizeit Beschäftigungsverbote und -beschränkungen Sonstige Pflichten des Arbeitgebers Gesundheitliche Betreuung | §§ 8- 46 JArbSchG §§ 8-21b JArbSchG §§ 22-27 JArbSchG §§ 28-31 JArbSchG §§ 32-46 JArbSchG |
Durchführung des Gesetzes | §§ 47-54 JArbSchG |
Straf- und Bußgeldvorschriften | §§ 58-60 JArbSchG |
Jugendarbeitsschutzgesetz Inhalt
Das Jugendarbeitsschutzgesetz enthält viele Schutzvorschriften zu der Möglichkeit für Jugendliche, beruflich tätig zu werden. Diese betreffen unter anderem:
- die Beschäftigungsverbote
- die Arbeitszeiten
- die Pausen
- den Urlaub
- die Berufsschule
Jugendlicher im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist, wer bereits 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, § 2 Abs. 2 JArbSchG.
Jugendarbeitsschutzgesetz verbotene Arbeiten
Es gibt einige Beschäftigungen, die generell für Jugendliche verboten sind. Der Grund dafür ist, dass diese Beschäftigungen ihre körperlichen Kräfte übersteigen oder sie bei ihnen besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Die Beschäftigungen, die für Jugendliche verboten sind, findest Du in § 22 Abs. 1 JArbSchG.
Unter anderem verboten sind die Beschäftigungen der Jugendlichen mit Arbeiten
- die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen (§ 22 Abs. 1 Nr. 1 JArbSchG)
- bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 JArbSchG)
- die mit Unfallgefahren verbunden sind (§ 22 Abs. 1 Nr. 3 JArbSchG)
- bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind (§ 22 Abs. 1 Nr. 5 JArbSchG)
Als Arbeiten, die die körperlichen Kräfte der Jugendlichen übersteigen, kommen beispielsweise in Betracht:
- das dauerhafte Arbeiten im Stehen,
- das Heben, Tragen und Bewegen schwerer Lasten
- die erhöhte Belastung des Sehvermögens durch die Beschäftigung
- das Arbeiten mit hoher gleichbleibender Dauerbelastung
In § 22 Abs. 2 JArbSchG findest Du die Ausnahmen, in denen das Beschäftigungsverbot des § 22 Abs. 1 Nr. 3 bis 7 JArbSchG nicht gilt.
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber bereits vor dem Beginn der Beschäftigung Jugendlicher die mit der Beschäftigung verbundenen Gefährdungen Jugendlicher beurteilen, § 28a S. 1 JArbSchG. Diese Beurteilung muss ergeben, dass die Gefahren, die von der Beschäftigung ausgehen können, den Jugendlichen zumutbar sind und sie nicht erheblich belasten.
Die §§ 23, 24 JArbSchG sehen generelle Verbote für die Akkord- und Fließbandarbeit und die Arbeit unter Tage vor. Dabei können auch diese Beschäftigungen in Ausnahmefällen möglich sein. Der Grund für das Verbot von Akkordarbeiten ist, dass es durch den Anreiz auf höheres Entgelt zu einem gesteigerten Arbeitstempo kommt. Dies kann zu einer starken Überforderung und einer Stresssituation des Jugendlichen führen.
Jana ist 17 Jahre alt und hat mit einer Ausbildung zur Veranstaltungstechnikerin begonnen. Dort ist sie häufig Lärm ausgesetzt und sie fragt sich, ob die Beschäftigung deswegen nicht eigentlich gem. § 22 Abs. 1 Nr. 5 JArbSchG verboten sein müsste.
Grundsätzlich dürfen Jugendliche keiner schädlichen Einwirkung von Lärm ausgesetzt werden, § 22 Abs. 1 Nr. 5 JArbSchG. Allerdings kann die Beschäftigung trotz des Lärms zulässig sein, wenn
- dies zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist
- und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist, § 22 Abs. 2 Nr. 1, 2 JArbSchG
Eine Veranstaltungstechnikerin ist zwangsläufig lauten Geräuschen während der Arbeit ausgesetzt. Allerdings ist dies für das Erlernen des Berufes notwendig und es können Schutzmaßnahmen, wie gehörschützende Kopfhörer genutzt werden. Zusätzlich müsste für den Schutz von Jana die Aufsicht durch einen Fachkundigen gewährleistet werden. Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, ist die Beschäftigung nicht verboten.
Jugendarbeitsschutzgesetz Arbeitszeit
Das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht verschiedene Einschränkungen für die Arbeitszeiten von Jugendlichen vor. Der Grund für die Beschränkung ist, dass die Jugendlichen ausreichend Freizeit haben sollen und nicht übermäßig von der Arbeit belastet sein sollen.
Die Vorschriften zu den Arbeitszeiten und der Freizeit, die für Jugendliche vorgesehen ist, findest Du in den §§ 8 bis 21b JArbSchG. In § 8 Abs. 1 JArbSchG heißt es:
Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden (§ 8 Abs. 1 JArbSchG).
Weiterhin wird in § 8 JArbSchG festgelegt, dass die reine Wochenarbeitszeit 40 Stunden nicht überschreiten darf. Die tägliche Arbeitszeit von acht Stunden kann um eine halbe Stunde verlängert werden, wenn ein anderer Arbeitstag in dieser Woche verkürzt wird, § 8 Abs. 2a JArbSchG.
Eine abweichende Regelung gilt gem. § 11 JArbSchG für die Schichtzeit. Die Schichtzeit umfasst gem. § 4 Abs. 2 JArbSchG die Gesamtheit von Arbeitszeiten und Ruhepausen. Diese darf bei der Beschäftigung von Jugendlichen maximal 10 Stunden pro Tag betragen.
Nach einem Arbeitstag müssen gem. § 13 JArbSchG 12 Stunden vergehen, bevor der nächste Arbeitstag begonnen werden kann. Der Grund für diese Regelung ist, dass die Jugendlichen ein angemessenes Maß an Freizeit und Zeit zur Erholung zur Verfügung gestellt bekommen sollen.
Unter welchen Voraussetzungen Jugendliche nachts arbeiten dürfen, ist in § 14 JArbSchG geregelt.
Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden (§ 14 Abs. 1 JArbSchG).
Den Jugendlichen muss also grundsätzliche eine Nachtruhe von 20 bis 6 Uhr gewährt werden. Ausnahmen sieht das Jugendarbeitsschutzgesetz in § 14 Abs. 2 JArbSchG für
- das Gaststätten- und Schaustellergewerbe
- den mehrschichtigen Betrieb
- die Landwirtschaft
- die Bäckereien und Konditoreien
vor.
An welchen Tagen Jugendliche arbeiten dürfen, ist in §§ 15-17 JArbSchG zu finden. § 15 JArbSchG sieht vor, dass Jugendliche nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden dürfen. Grundsätzlich dürfen Jugendliche gem. § 16 Abs. 1 JArbSchG nicht an Samstagen beschäftigt werden, wenn es nicht gem. § 16 Abs. 2 JArbSchG ausnahmsweise zulässig ist. Dasselbe Beschäftigungsverbot gilt für Sonntage, § 17 Abs. 1 JArbSchG. Auch dort findest Du die Ausnahmefälle in § 17 Abs. 2 JArbSchG. Letztlich dürfen Jugendliche grundsätzlich nur von Montag bis Freitag beschäftigt werden.
An Feiertagen gilt gem. § 18 Abs. 1 JArbSchG ein generelles Beschäftigungsverbot.
Carolin ist 17 Jahre alt und arbeitet in einer Konditorei. Dort beginnt ihr Arbeitstag bereits um 5:30 Uhr und sie arbeitet von Dienstag bis Samstag pro Tag acht Stunden.
Frage: Sind die Arbeitszeiten von Carolin nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz erlaubt?
Lösung:
Zunächst kannst Du Dich fragen, ob Carolin eine Jugendliche im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist. Jugendlicher ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, § 2 Abs. 2 JArbSchG. Carolin ist 17 Jahre alt und damit eine Jugendliche.
Jugendliche dürfen gem. § 8 Abs. 1 JArbSchG nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden in der Woche beschäftigt werden. Carolin arbeitet an fünf Tagen acht Stunden und damit insgesamt 40 Stunden in der Woche.
Problematisch könnte sein, dass die Arbeitszeit von Carolin bereits um 5:30 Uhr beginnt. Jugendliche dürfen gem. § 14 Abs. 1 JArbSchG nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr arbeiten. Allerdings sieht § 14 Abs. 2 Nr. 4 JArbSchG eine Ausnahme für Bäckereien und Konditoreien vor. Bei diesen Arbeitsstellen können Jugendliche bereits ab 5 Uhr arbeiten, wenn sie über 16 Jahre alt sind. Carolin ist 17 Jahre alt, sodass es möglich ist, dass ihr Arbeitstag bereits um 5:30 Uhr beginnt.
Carolin arbeitet an fünf Tagen in der Woche und die Ruhetage folgen aufeinander, sodass die Voraussetzungen von § 15 JArbSchG erfüllt sind.
Möglicherweise darf sie allerdings nicht am Samstag arbeiten. Gem. § 16 Abs. 1 JArbSchG dürfen Jugendliche an Samstagen nicht beschäftigt werden. Allerdings arbeitet Carolin in einer Bäckerei. § 16 Abs. 2 Nr. 2 JArbSchG sieht vor, dass eine Beschäftigung von Jugendlichen an Samstagen in Bäckereien zulässig ist. Die Beschäftigung am Samstag ist dadurch möglich, dass Carolin am Montag zusätzlich freigestellt ist, § 16 Abs. 3 S. 1 JArbSchG.
Die Arbeitszeiten von Carolin sind somit nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz zulässig.
Jugendarbeitsschutzgesetz Pausen
Auch in Bezug auf die Pausenzeiten sieht das Jugendarbeitsschutzgesetz besondere Regelungen vor. Die Einhaltung der Pausen ist für Jugendliche von besonderer Bedeutung, um die Erholung von der Arbeit zu ermöglichen. Die erforderliche Dauer für die Ruhepausen ist in § 11 Abs. 1 JArbSchG geregelt. Dort heißt es:
Jugendlichen müssen im voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer gewährt werden (§ 11 Abs. 1 S. 1 JArbSchG).
Welche Dauer angemessen ist, ist abhängig von der täglichen Arbeitszeit:
- Arbeitstag von 4,5 bis 6 Stunden à 30 Minuten Pause
- Arbeitstag von mehr als 6 Stunden à 1 Stunde Pause
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten in angemessener zeitlichen Lage, um sich von der Arbeitszeit erholen zu können.
Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlichen Lage gewährt werden, § 11 Abs. 2 S. 1 JArbSchG. Das bedeutet, dass sie frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit eingeplant werden müssen.
Hanna ist 16 Jahre alt und arbeitet zweimal in der Woche in einem Restaurant. An einem Tag arbeitet sie fünf Stunden und an dem anderen sieben Stunden.
Frage: Wie muss das Restaurant die Ruhepausen von Hanna einplanen?
Lösung:
Hanna ist eine Jugendliche (§ 2 Abs. 2 JArbSchG), sodass ihr eine feststehende Ruhepause gewährt werden muss, § 11 Abs. 1 S. 1 JArbSchG. An dem Tag, an dem sie fünf Stunden arbeitet, muss die Ruhepause mindestens 30 Minuten betragen, § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 JArbSchG. An dem Tag, mit einer Arbeitszeit von sieben Stunden, muss die Pause von Hanna mindestens 60 Minuten andauern, § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 JArbSchG. Außerdem müssen die Ruhepausen frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit gewährt werden, § 11 Abs. 2 S. 1 JArbSchG.
Jugendarbeitsschutzgesetz Urlaub
Die Vorschrift zum Urlaub findest Du in § 19 JArbSchG.
Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub zu gewähren (§ 19 Abs. 1 JArbSchG).
Die Dauer des Urlaubs ist abhängig von dem Alter des Jugendlichen zum Beginn des Kalenderjahres:
Alter des Jugendlichen | Dauer des Urlaubs |
unter 16 Jahren | mindestens 30 Werktage |
zwischen 16 und 17 Jahre | mindestens 27 Werktage |
zwischen 17 und 18 | mindestens 25 Werktage |
Johanna ist zu Beginn des Kalenderjahres 2020 16 Jahre alt und arbeitet in einem Baumarkt. Sie fragt sich, wie viele Urlaubstage sie im Jahr hat. Dadurch, dass sie noch nicht 17 Jahre alt ist, hat sie einen Anspruch auf mindestens 27 Werktage bezahlten Erholungsurlaub, § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 JArbSchG.
Jugendarbeitsschutzgesetz Berufsschule
Auch in Bezug auf die Berufsschule sieht das Jugendarbeitsschutzgesetz einige Sonderregelungen vor. Diese findest Du in den §§ 9 und 10 JArbSchG und sie betreffen alle Jugendliche, die im Rahmen Berufsausbildung beschäftigt sind.
Die Berufsausbildung findet an zwei verschiedenen Orten statt. Zum einen im jeweiligen Betrieb und zum anderen in der Berufsschule. Im Ausbildungsbetrieb lernst Du die praktischen Inhalte Deiner Ausbildung, die auf das jeweilige Unternehmen bezogen sind. Die Berufsschule besuchst Du parallel dazu, um die theoretischen Inhalte zu lernen. Während der Ausbildung wechseln sich Theorie und Praxis ab.
Wenn Du mehr über die Regelungen in Bezug auf die Berufsausbildung erfahren möchtest, kannst Du Dir die Erklärung "Rechtliche Grundlagen der Berufsausbildung" und "Berufsbildungsgesetz" näher ansehen.
In § 9 Abs. 1 S. 1 JArbSchG ist festgelegt, dass der Arbeitgeber den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufsunterricht freistellen muss. Das heißt, dass der Jugendliche nicht im Betrieb arbeiten muss, um die Berufsschule zu besuchen. Der Arbeitgeber muss deshalb die Arbeitszeiten des Jugendlichen so organisieren, dass es möglich ist, dass der Jugendliche den Berufsunterricht wahrnehmen kann.
Für den Arbeitgeber gilt ein Beschäftigungsverbot des Jugendlichen:
- vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht (§ 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 JArbSchG)
- für den ganzen Tag, an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden (§ 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 JArbSchG)
- für mindestens fünf Tage, in Berufsschulwochen, mit einem Blockunterricht von mindestens 25 Stunden (§ 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 JArbSchG)
Des Weiteren muss der Arbeitgeber den Jugendlichen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 JArbSchG für die Teilnahme an Prüfungen und außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen freistellen. Zusätzlich darf der Jugendliche an dem Arbeitstag unmittelbar vor der schriftlichen Abschlussprüfung nicht beschäftigt werden, § 10 Abs. 1 Nr. 2 JArbSchG.
Jugendarbeitsschutzgesetz Untersuchungen
Eine weitere Besonderheit des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist, dass es die Arbeitgeber*innen unter Umständen zu bestimmten Gesundheitsbetreuungsmaßnahmen verpflichtet. Die Regelungen zu der gesundheitlichen Betreuung findest Du in den §§ 32 bis 46 JArbSchG.
Das Ziel der gesundheitlichen Betreuung ist, dass Gesundheitsschäden durch die Beschäftigung für die Jugendlichen vermieden werden sollen.
Erstuntersuchung Jugendarbeitsschutzgesetz
§ 32 JArbSchG sieht eine Erstuntersuchung bei Beginn der Beschäftigung eines Jugendlichen vor. Genauer heißt es dort:
Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt werden, wenn
- er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden ist (Erstuntersuchung) und
- dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt (§ 32 Abs. 1 JArbSchG).
Die Erstuntersuchung ist also eine aktuelle ärztliche Untersuchung, deren Bescheinigung dem Arbeitgeber vorgezeigt werden muss. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass der Jugendliche beschäftigt werden darf.
Die Pflicht zur Erstuntersuchung trifft jeden Jugendlichen, der eine Beschäftigung aufnehmen möchte, bis er 18 Jahre alt ist.
Notwendig ist eine Erstuntersuchung nicht für eine nur geringfügige oder eine weniger als zwei Monate dauernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesundheitlichen Nachteile für den Jugendlichen zu befürchten sind, § 32 Abs. 2 JArbSchG.
Weitere Untersuchungen
Ein Jahr nach der Aufnahme der Beschäftigung muss der Jugendliche dem Arbeitgeber die ärztliche Bescheinigung darüber vorlegen, dass er nachuntersucht worden ist, § 33 Abs. 1 S. 1 JArbSchG.
Durch diese Nachuntersuchung soll festgestellt werden, ob die Beschäftigung negative gesundheitliche Folgen hervorgerufen hat. Es soll daher die Auswirkungen des ersten Beschäftigungsjahres auf die Entwicklung und die Gesundheit des Jugendlichen herausgefunden werden.
Nach jedem weiteren Jahr der Beschäftigung kann sich der Jugendliche erneut nachuntersuchen lassen, § 34 S. 1 JArbSchG. Diese weiteren Nachuntersuchungen sind jedoch für den Jugendlichen freiwillig und keine Voraussetzung für die weitere Beschäftigung. Dennoch soll der Arbeitgeber gem. § 34 S. 2 JArbSchG darauf hinwirken, dass der Jugendliche die Möglichkeit weiterer Nachuntersuchungen wahrnimmt.
Durchführung der Untersuchungen
Möglicherweise stellst Du Dir die Frage, wer die ärztlichen Untersuchungen vornehmen kann. Die Untersuchung kann von jedem Arzt vorgenommen werden, wobei keine speziellen Anforderungen an die Auswahl des Arztes gestellt sind. Es besteht also eine freie Arztwahl für den Jugendlichen. Außerdem sieht § 44 JArbSchG vor, dass die Kosten der Untersuchungen das Land trägt.
Benni möchte eine Ausbildung zum Krankenpfleger machen und dazu langfristig in einem Krankenhaus arbeiten. Er fragt sich, ob eine ärztliche Untersuchung erforderlich ist.
Die Beschäftigung von Benni ist nur möglich, wenn er innerhalb der letzten 14 Monate von einem Arzt untersucht worden ist und seinem Arbeitgeber die ärztliche Bescheinigung vorlegen kann. Dadurch, dass es sich nicht um eine geringfügige oder eine kurzzeitige Beschäftigung mit leichten Arbeiten handelt, ist eine Erstuntersuchung gem. § 32 JArbSchG notwendig. Ein Jahr nach der Aufnahme der Beschäftigung muss Benni eine Nachuntersuchung durchführen lassen und die Bescheinigung seinem Arbeitgeber vorlegen, § 33 Abs. 1 JArbSchG. Weitere Nachuntersuchungen können jedes Jahr freiwillig vorgenommen werden, § 34 JArbSchG.
Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz
Die Folgen eines Verstoßes gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz findest Du in den §§ 58 bis 60 JArbSchG. Aufgrund der hohen Bedeutung des Schutzes von Jugendlichen wird ein Verstoß gegen die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes als Ordnungswidrigkeit oder in besonders schwerwiegenden Fällen als Straftat geahndet.
Die Straf- und Bußgeldvorschriften findest Du im Einzelnen in den §§ 58, 59 JArbSchG. Dort sind auch die Voraussetzungen einer Bestrafung oder einer Geldbuße festgelegt.
Ein Verstoß kann gem. § 58 Abs. 4 JArbSchG mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 30.000 € sanktioniert werden. Der Bußgeldrahmen in § 59 Abs. 3 JArbSchG beträgt 5.000 €.
Cindy ist 17 Jahre alt und arbeitet in einem Restaurant. Normalerweise hat sie eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden, die gleichmäßig auf die Tage von Dienstag bis Samstag aufgeteilt sind. In den letzten Monaten haben allerdings zwei Mitarbeiterinnen gekündigt, sodass der Arbeitgeber die wöchentliche Dauer der Arbeitszeit von Cindy auf 45 Stunden erhöht hat. Cindy fragt sich, ob ihr Arbeitgeber damit nicht gegen die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes verstößt.
Jugendliche dürfen gem. § 8 Abs. 1 JArbSchG nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. Cindys wöchentliche Arbeitszeit wurde auf 45 Stunden erhöht, sodass sie über die gesetzlich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit hinaus beschäftigt wird. Dadurch, dass der Arbeitgeber von Cindy eine Jugendliche über die zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus beschäftigt, handelt er gem. § 58 Abs. 1 Nr. 5 JArbSchG ordnungswidrig. Die Konsequenz davon ist, dass gegen den Arbeitgeber von Cindy eine Geldbuße bis zu 30.000 € (§ 58 Abs. 4 JArbSchG) verhängt werden kann.
Jugendarbeitsschutzgesetz – Das Wichtigste
- Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) verfolgt das Ziel, Jugendliche im Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis zu schützen.
- Junge Menschen sollen vor einer Gefährdung ihrer Gesundheit, Überforderung, zu hoher Arbeitsbelastung, einer Störung ihrer Entwicklung, einer Überbeanspruchung und zu langen Arbeitszeiten bewahrt werden.
- Unter den Anwendungsbereich des Jugendarbeitsschutzgesetzes fällt jeder junge Mensch, der unter 18 Jahre alt ist und in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis steht.
- Ein Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist. Jugendlicher ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, § 2 JArbSchG.
- Eine Beschäftigung von Kindern ist gem. § 5 Abs. 1 JArbSchG generell verboten, wobei es Ausnahmen gibt.
- Verboten sind solche Beschäftigungen, die die körperlichen Kräfte der Jugendlichen übersteigen oder sie bei der Beschäftigung besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Die verbotenen Beschäftigungen sind in § 22 Abs. 1 JArbSchG genannt.
- Generell gilt ein Verbot von Akkord- und Fließbandarbeiten und der Arbeit unter Tage, §§ 23, 24 JArbSchG.
- Grundsätzlich dürfen Jugendliche maximal 8 Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden, § 8 Abs. 1 JArbSchG.
- Sie dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden und grundsätzlich nicht an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, § 15 ff. JArbSchG.
- Auch in Bezug auf die Ruhepausen und den Urlaub sieht das Jugendarbeitsschutzgesetz spezielle Regelungen vor, um dem Jugendlichen genügend Freizeit zur Erholung zu verschaffen.
- Der Arbeitgeber muss den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufsunterricht freistellen, § 9 Abs. 1 S. 1 JArbSchG.
- Bevor die Beschäftigung aufgenommen werden kann, muss eine ärztliche Erstuntersuchung durchgeführt werden, § 32 JArbSchG. Ein Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung muss der Jugendliche eine erste Nachuntersuchung vornehmen lassen, § 33 JArbSchG.
Nachweise
- Kiel; Lunk; Oetker(2021). Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht. Band 2: Individualarbeitsrecht II. Verlag C.H. Beck oHG. 5. Auflage.
- Waltermann (2021). Arbeitsrecht. Verlag Franz Vahlen. 20. Auflage.
- Otto; Bieder(2019). Arbeitsrecht. Verlag De Gruyter.
- Weyand (2016). Jugendarbeitsschutzgesetz. Nomos Verlag. 2. Auflage.
Lerne schneller mit den 5 Karteikarten zu Jugendarbeitsschutzgesetz
Melde dich kostenlos an, um Zugriff auf all unsere Karteikarten zu erhalten.
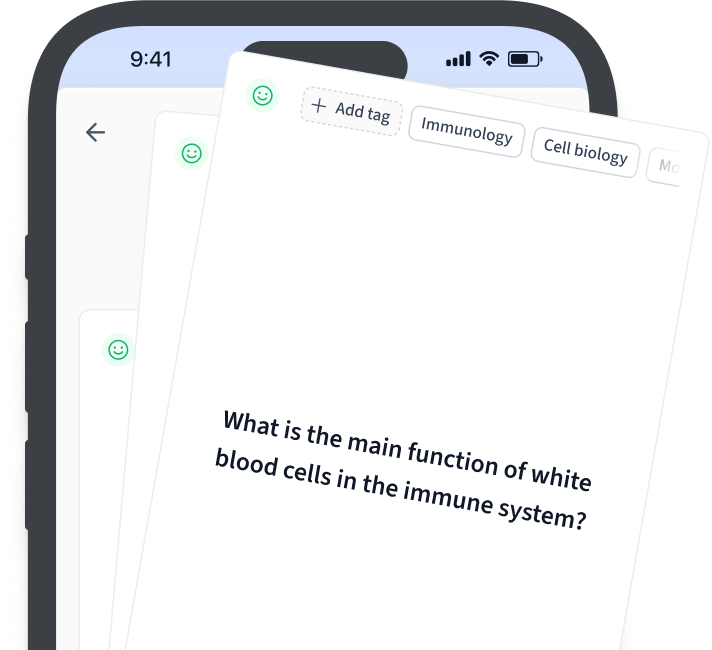
Häufig gestellte Fragen zum Thema Jugendarbeitsschutzgesetz
Wer fällt unter das Jugendarbeitsschutzgesetz?
Unter den Anwendungsbereich des Jugendarbeitsschutzgesetzes fallen alle jungen Menschen, die unter 18 Jahre alt sind.
Jugendliche im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes sind Menschen, die 15, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, § 2 Abs. 2 JArbSchG. Ein Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist, § 2 Abs. 1 JArbSchG.
Was sagt das Jugendarbeitsschutzgesetz?
Das Jugendarbeitsschutzgesetz beinhaltet Regelungen, die Jugendliche im Arbeitsleben vor Überforderung und gesundheitlicher Belastung schützen sollen. Die Jugendlichen sollen davor geschützt werden, dass sie eine Beschäftigung ausführen, die sie körperlich und seelisch zu stark belastet.
Welche Arbeiten sind nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz verboten?
Verboten sind solche Beschäftigungen, die die körperlichen Kräfte der Jugendlichen übersteigen oder sie bei der Beschäftigung besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Die verbotenen Beschäftigungen sind in § 22 Abs. 1 JArbSchG genannt. Generell gilt ein Verbot von Akkord- und Fließbandarbeiten und der Arbeit unter Tage, §§ 23, 24 JArbSchG.
Was ist die Erstuntersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz?
Die Erstuntersuchung ist eine ärztliche Untersuchung, die innerhalb der letzten 14 Monate vor dem Beginn der Beschäftigung von einem Arzt durchgeführt werden muss.


Über StudySmarter
StudySmarter ist ein weltweit anerkanntes Bildungstechnologie-Unternehmen, das eine ganzheitliche Lernplattform für Schüler und Studenten aller Altersstufen und Bildungsniveaus bietet. Unsere Plattform unterstützt das Lernen in einer breiten Palette von Fächern, einschließlich MINT, Sozialwissenschaften und Sprachen, und hilft den Schülern auch, weltweit verschiedene Tests und Prüfungen wie GCSE, A Level, SAT, ACT, Abitur und mehr erfolgreich zu meistern. Wir bieten eine umfangreiche Bibliothek von Lernmaterialien, einschließlich interaktiver Karteikarten, umfassender Lehrbuchlösungen und detaillierter Erklärungen. Die fortschrittliche Technologie und Werkzeuge, die wir zur Verfügung stellen, helfen Schülern, ihre eigenen Lernmaterialien zu erstellen. Die Inhalte von StudySmarter sind nicht nur von Experten geprüft, sondern werden auch regelmäßig aktualisiert, um Genauigkeit und Relevanz zu gewährleisten.
Erfahre mehr
