Springe zu einem wichtigen Kapitel
Welche genaue Bedeutung dem Betriebsverfassungsgesetz zukommt, welchen Geltungsbereich es umfasst, was der Betriebsrat, die Betriebsversammlung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist und welche Regelungen über die Mitbestimmung getroffen werden, erfährst Du in dieser Erklärung.
Betriebsverfassungsgesetz Definition
Das Betriebsverfassungsgesetz wird dem Bereich des kollektiven Arbeitsrechts zugeordnet und kann mit BetrVG abgekürzt werden. Die ursprüngliche Fassung des Gesetzes ist am 14.11.1952 in Kraft getreten. Eine umfassende Neuerung führte zu einer Neubekanntmachung am 25.09.2001. Am 18.06.2021 ist das Betriebsrätemordernisierungsgesetz in Kraft getreten, das auch Änderungen des Betriebsverfassungsgesetzes enthält.
Im Arbeitsrecht wird zwischen dem Individual- und Kollektivarbeitsrecht unterschieden.
Das Individualarbeitsrecht regelt die individuelle Beziehung zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen.
Dies bedeutet, dass das Individualarbeitsrecht alle Regelungen beinhaltet, die das Vertragsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber betreffen. Des Weiteren enthält es eine Vielzahl von Vorschriften, die dem Arbeitnehmerschutz dienen.
Davon zu unterscheiden ist das kollektive Arbeitsrecht.
Das Kollektivarbeitsrecht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgeber*innen sowie zwischen den Betriebsräten und Arbeitgeber*innen.
Dabei enthält das Kollektivarbeitsrecht unter anderem das Tarifrecht und das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer*innen. Es regelt die Beziehung der Organisationen der Arbeitnehmer*innen und die der Arbeitgeber*innen und deren Rechtsbeziehungen zueinander.
Da das Betriebsverfassungsgesetz die Beziehung zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat beschreibt, gehört es zum Kollektivarbeitsrecht.
Das Betriebsverfassungsgesetz regelt die innerbetriebliche Ordnung und die Mitbestimmung von Arbeitnehmer*innen im Betrieb. Gegenüber dem Arbeitgeber werden die Arbeitnehmer*innen durch den Betriebsrat vertreten.
Es wird die Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat näher bestimmt. Dadurch ergeben sich für die Beteiligten Rechte und Pflichten.
Durch das Betriebsverfassungsgesetz soll gewährleistet werden, dass die Arbeitnehmer*innen an den Entscheidungen des Arbeitgebers teilhaben können. Der Arbeitgeber soll seine Macht zur betrieblichen Leitung nicht vollkommen frei und willkürlich ausüben können, sondern die Arbeitnehmer*innen sollen die Möglichkeit haben mitzubestimmen und mitzuwirken.
Das Betriebsverfassungsgesetz ist nur anwendbar, wenn der sachliche und persönliche Geltungsbereich des BetrVG betroffen ist.
Sachlicher Geltungsbereich
Der sachliche Geltungsbereich bezieht sich auf das thematische Gebiet, das vom Betriebsverfassungsgesetz umfasst wird. §§ 1 und 4 BetrVG beinhalten den Begriff des Betriebs, wodurch der sachliche Geltungsbereich definiert wird.
In § 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG wird festgelegt, dass Betriebe mit mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, von dem Gesetz erfasst werden. Dabei wird nicht näher darauf eingegangen, was unter einem Betrieb zu verstehen ist.
Ein Betrieb ist eine organische Einheit, innerhalb derer Arbeitgeber mit Arbeitnehmern bestimmte arbeitstechnische Ziele verfolgen und dazu Wirtschaftsgüter produziert oder Dienstleistungen erbracht werden.
Näher definiert werden gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen sowie Betriebsteile und Kleinstbetriebe.
Ein gemeinsamer Betrieb ist ein Betrieb mehrerer Unternehmen, § 1 Abs. 1 S. 2 BetrVG.
Zwei Anhaltspunkte, bei deren Vorliegen ein gemeinsamer Betrieb vermutet wird, werden in § 1 Abs. 2 BetrVG genannt:
- Einheitliche Leitung, wodurch der arbeitstechnische Zweck erreicht werden soll
- Führungsvereinbarung, durch die sich auf die einheitliche Leitung geeinigt wird
Durch § 4 BetrVG wird der Betriebsbegriff des § 1 BetrVG für die Thematik der Betriebsteile ergänzt. In § 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG heißt es:
Betriebsteile gelten als selbstständige Betriebe, wenn sie die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllen und1. räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder2. durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig sind.
Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, werden auch Betriebsteile als selbstständiger Betrieb anerkannt.
Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG nicht vor, sind diese Betriebe dem Hauptbetrieb zuzuordnen, § 4 Abs. 2 BetrVG. Wenn also ein Betrieb gegeben ist, in dem weniger als fünf Arbeitnehmer*innen beschäftigt, liegt ein Kleinstbetrieb vor, der dem Hauptbetrieb zugeordnet wird.
Unanwendbar ist das Betriebsverfassungsgesetz bei:
- Kleinstbetrieben, da dort weniger als fünf ständige wahlberechtigte Arbeitnehmer*innen beschäftigt sind, § 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG
- Betrieben eines Trägers des öffentlichen Rechts, da sie dem Personalvertretungsrecht unterstehen, § 130 BetrVG
- Betrieben von Religionsgemeinschaften, § 118 Abs. 2 BetrVG
Persönlicher Geltungsbereich
Der persönliche Geltungsbereich beinhaltet, welche persönlichen Voraussetzungen die Arbeitnehmer*innen aufweisen müssen, damit das Betriebsverfassungsgesetz Anwendung findet. Dieser persönliche Geltungsbereich wird durch den Begriff des Arbeitnehmers in § 5 BetrVG definiert.
Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. Als Arbeitnehmer gelten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte), Soldaten (Soldatinnen und Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes [...], die in Betrieben privatrechtlich organisierter Unternehmen tätig sind (§ 5 Abs. 1 BetrVG).
In § 5 Abs. 2 BetrVG sind Ausnahmen genannt, in welchen Fällen keine Arbeitnehmer vorliegen. Dies sind unter anderem diese Personengruppen:
- Mitglieder des Organs, das die juristische Person gesetzlich vertritt
- Gesellschafter einer OHG
- Personen, deren Beschäftigung durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist
- Personen, die zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlicher Besserung oder Erziehung beschäftigt werden
- der Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben
Weiterhin findet das Betriebsverfassungsgesetz keine Anwendung auf leitende Angestellte, § 5 Abs. 3, 4 BetrVG. Wer ein leitender Angestellter ist, wird in § 5 Abs. 3 S. 2 BetrVG festgehalten.
Damit ein Betrieb betriebsfähig ist, müssen fünf ständig beschäftigte, wahlberechtigte Arbeitnehmer*innen, von denen drei wählbar sind, beschäftigt werden, § 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG.
Betriebsverfassungsgesetz Inhalt
In dem Betriebsverfassungsgesetz wird die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und dem Betriebsrat festgelegt. Dazu werden die Grundlagen der Regelungen zum Betriebsrat, zur Betriebsversammlung, zur betrieblichen Jugend- und Auszubildendenvertretung, Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer und dem Mitwirkungs- und Beschwerderecht des Arbeitnehmers in acht Teilen mit jeweiligen Kapiteln und Abschnitten festgehalten.
Das Betriebsverfassungsgesetz enthält unter anderem Vorschriften für diese Bereiche:
- Errichtung von Betriebsräten
- Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber
- Arbeitnehmer
- Wahl des Betriebsrats
- Geschäftsführung des Betriebsrates
- Betriebsversammlung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer
- Mitwirkungs- und Beschwerderecht des Arbeitnehmers
Damit Du Dir den Aufbau des Betriebsverfassungsgesetzes besser vorstellen kannst, wird er hier in grob einer Tabelle dargestellt:
| Abschnitte | Paragraphen |
Erster Teil:
| §§ 1 - 6 BetrVG |
Zweiter Teil
| §§ 7 - 59a BetrVG |
Dritter Teil:
| §§ 60 - 73b BetrVG |
Vierter Teil:
| §§ 74 - 113 BetrVG |
Fünfter Teil:
| §§ 114 - 118 BetrVG |
Sechster Teil:
| §§ 119 - 121 BetrVG |
Siebenter Teil:
| §§ 122 - 124 BetrVG |
Achter Teil:
| §§ 125 - 132 BetrVG |
Betriebsverfassungsgesetz Betriebsrat
Eines der Funktionen des Betriebsverfassungsgesetzes ist es, zu regeln, unter welchen Voraussetzungen der Betriebsrat zustande kommen kann.
Der Betriebsrat ist ein Zusammenschluss von Arbeitnehmer*innen, der die Arbeitnehmerinteressen in einem Betrieb gegenüber dem Arbeitgeber vertritt.
Die einzelnen Mitglieder des Betriebsrats sind von dem Oberbegriff des Betriebsrats zu unterscheiden.
Ein Mitglied des Betriebsrats ist ein von Arbeitnehmer*innen eines Betriebes gewählter Vertreter, der ihre Interessen wahrnehmen soll und sie vor dem Arbeitgeber repräsentiert.
Wie viele Mitglieder der Betriebsrat hat, ist abhängig davon, wie groß das Unternehmen ist und wie viele Arbeitnehmer*innen beschäftigt werden.
Mehr zum Thema Betriebsrat findest Du in der gleichnamigen Erklärung!
Pflichten des Betriebsrats
Das Betriebsverfassungsgesetz enthält die Rechte und Pflichten des Betriebsrats. Allgemein ist der Betriebsrat dafür verantwortlich, die Interessen und Rechte der Arbeitnehmer*innen gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten. Weitere allgemeine Aufgaben sind in § 80 Abs. 1 BetrVG festgehalten. Darunter fallen unter anderem:
- Maßnahmen, die dem Betrieb und den Arbeitnehmer*innen dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen,
- die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern
- die Eingliederung schwerbehinderter Menschen
- die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durchzuführen
- die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer*innen im Betrieb zu fördern
- die Integration ausländischer Arbeitnehmer*innen im Betrieb zu fördern
- Maßnahmen, die dem Arbeitsschutz und dem betrieblichen Umweltschutz dienen, zu fördern
Die in § 80 Abs. 1 BetrVG genannten Aufgaben dienen der Mitbestimmung im Betrieb und Unternehmen durch den Betriebsrat. Die Rechte des Betriebsrats sind insgesamt Beteiligungsrechte. Die Aufgaben des § 80 BetrVG können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden:
- ÜberwachungsaufgabenDer Betriebsrat muss überwachen, ob Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zugunsten der Arbeitnehmer*innen eingehalten und durchgeführt werden. Dazu gehört auch die Einhaltung arbeitsrechtlicher Grundsätze wie dem Gleichbehandlungsgrundsatz, den Regelungen zum Arbeitsschutz oder Unfallverhütungsvorschriften.
- GestaltungsaufgabenEs soll durch den Betriebsrat nicht nur die bestehende Situation überwacht werden, sondern die Zustände sollen gestaltet werden können. Unter anderem kann der Betriebsrat Maßnahmen für die Belegschaft ergreifen, ihre Anregungen anzunehmen und diese umzusetzen.
- Schutzaufgaben Personen, denen besonderer Schutz zugutekommen muss, sollen durch den Betriebsrat zusätzlich geschützt werden. Dem Betriebsrat kommt die Aufgabe zu, Arbeitnehmer*innen mit Schwerbehinderung, ältere Arbeitnehmer*innen und ausländische Arbeitnehmer*innen aktiv vor Benachteiligungen und Diskriminierung zu schützen.
- Förderungsaufgaben Eine weitere Aufgabe, die dem Betriebsrat zukommt, ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Betrieb. Zusätzlich muss die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit gefördert werden.
Wahl des Betriebsrats
Im Betriebsverfassungsgesetz haben die Begriffe Betriebsrat und Mitglieder des Betriebsrats unterschiedliche Wirkungen. Wird der Begriff Betriebsrat verwendet, ist das Kollegialorgan als Gremium angesprochen. Wird Mitglieder des Betriebsrats genutzt, werden die einzelnen Mitglieder individuell angesprochen.
Die Amtszeit des Betriebsrats beträgt gem. § 21 BetrVG vier Jahre. Die Betriebsratswahlen finden dabei alle vier Jahre in der Zeit vom 01. März bis 31. Mai statt, § 13 Abs. 1 BetrVG. Das Amt der einzelnen Betriebsratsmitglieder beginnt und endet mit der Amtszeit des Betriebsrats, dem sie angehören. Das Erlöschen der Mitgliedschaft wird durch § 24 BetrVG geregelt:
Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt durch1. Ablauf der Amtszeit,2. Niederlegung des Betriebsratsamtes,
3. Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
4. Verlust der Wählbarkeit,
5. Ausschluss aus dem Betriebsrat oder Auflösung des Betriebsrats auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung,
6. Gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der Nichtwählbarkeit [...].
Sollte ein Mitglied des Betriebsrats ausscheiden, rückt ein Ersatzmitglied nach, § 25 Abs. 1 S. 1 BetrVG.
Rechte des Betriebsrats
Die Rechte des Betriebsrats als Gremium sind:
- Informationsrechte
- Mitwirkungsrechte
- Mitbestimmungsrechte
Das Informationsrecht ist in § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG festgelegt.
Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und umfasst insbesondere den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben dieser Personen.
Der Betriebsrat muss dabei alle Informationen vom Arbeitgeber erhalten, die er für die Erledigung seiner Aufgaben benötigt.
Die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats sind:
- der Arbeitgeber muss den Betriebsrat anhören und sich mit dessen Vorbringen beschäftigen (Anhörungsrecht)
- der Arbeitgeber und der Betriebsrat müssen die Angelegenheiten gemeinsam erörtern (Beratungsrecht)
Mitbestimmungsrechte ermöglichen dem Betriebsrat, die Verhältnisse im Betrieb tatsächlich zu verändern und über Veränderungen mitzubestimmen. Zu den Mitbestimmungsrechten gehören gem. § 87 BetrVG die Mitbestimmung:
- bei Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer*innen im Betrieb
- bei dem Beginn und dem Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen
- bei der Zeit, dem Ort und der Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte
- bei der Form, der Ausgestaltung und der Verwaltung von Sozialeinrichtungen
Weitere Informationen über die Mitbestimmung, die das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht, erfährst Du weiter unten in dieser Erklärung.
Rechte der einzelnen Betriebsratsmitglieder sind:
- Recht auf Freistellung
- Recht auf Kündigungsschutz
Eines der Mitglieder des Betriebsrats muss sich im Zweifelsfall in Vollzeit um die Belange der Arbeitnehmer*innen kümmern. Insbesondere bei großen Unternehmen mit einer Vielzahl von Arbeitnehmer*innen ist dies der Fall. Dazu muss das Mitglied des Betriebsrats gesetzlich freigestellt werden, um seine Tätigkeiten als Betriebsratsmitglied vollumfänglich wahrnehmen zu können. Ab welcher Anzahl von Arbeitnehmer*innen wie viele Mitglieder des Betriebsrats von ihrer beruflichen Tätigkeit freizustellen sind, ist in § 38 Abs. 1 BetrVG festgelegt.
Der besondere Kündigungsschutz, der für Mitglieder des Betriebsrats gilt, ist im Kündigungsschutzgesetz geregelt.
Weiteres über die Kündigung von Betriebsratsmitgliedern findest Du weiter unten in dieser Erklärung oder in der Erklärung Kündigungsschutz.
Betriebsverfassungsgesetz Mitbestimmung
Das Betriebsverfassungsgesetz enthält in den §§ 74 bis 80 BetrVG Regelungen zu Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechten des Betriebsrats. Die Rechte des Betriebsrats lassen sich unter dem Oberbegriff Beteiligungsrechte zusammenfassen.
Es gibt verschiedene Stufen, in die die Beteiligungsrechte des Betriebsrats eingeteilt werden können:
- Unterrichtungsrechte
- Anhörungsrechte
- Beratungsrechte
- Widerspruchsrechte
- Zustimmungsverweigerungsrechte
- „echte“ Mitbestimmungsrechte
Unterrichtungsrechte
Die Unterrichtungsrechte sind Informations- und Mitteilungsrechte und können in eigenständige und vorgeschaltete Unterrichtungsrechte unterteilt werden.
Eigenständige Unterrichtungsrechte beinhalten eine allgemeine Pflicht des Arbeitgebers zur vertrauensvollen Zusammenarbeit (§ 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG).
Darunter fallen auch Spezialvorschriften wie § 105 BetrVG, nach der der Arbeitgeber dem Betriebsrat mitteilen muss, wenn eine Veränderung des leitenden Angestellten vorgenommen werden soll.
Vorgeschaltete Unterrichtungsrechte sind die Grundlage für weitergehende Beteiligungsrechte des Betriebsrats.
Solche sind etwa in § 99 Abs. 1 BetrVG in Bezug auf die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen enthalten.
Der allgemeine Auskunftsanspruch ist in § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG geregelt. Dort heißt es:
Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und umfasst insbesondere den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben dieser Personen.
Der Betriebsrat muss als über wichtige Themen von dem Arbeitgeber unterrichtet werden.
Anhörungsrecht
Die Anhörungsrechte des Betriebsrats können in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt werden. Es gibt:
- das allgemeine Anhörungsrecht
- das entscheidungsbezogene Anhörungsrecht
Dem Betriebsrat kommt dabei grundsätzlich das Recht zu, durch den Arbeitgeber vor einer Entscheidung angehört zu werden.
Ein allgemeines Anhörungsrecht besteht bei den Fällen, die in § 80 Abs. 1 BetrVG unter die allgemeinen Aufgaben gefasst sind. Entscheidungsbezogene Anhörungsrechte sollen sicherstellen, dass der Betriebsrat auf die Entscheidung des Arbeitgebers tatsächlich einwirken kann. Unter anderem ist der Betriebsrat gem. § 102 Abs. 1 S. 1 vor jeder Kündigung anzuhören.
Beratungsrecht
Das Beratungsrecht unterscheidet sich in seiner Intensität von dem Anhörungsrecht.
Durch das Beratungsrecht hat der Betriebsrat einen Anspruch darauf, die Entscheidung über bestimmte Themen mit dem Arbeitgeber gemeinsam zu erörtern.
Es geht über den Bereich des Anhörungsrechts hinaus, weil der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat zusammen die entscheidenden Themen besprechen und ihn nicht nur anhören muss. Aus § 74 Abs. 1 BetrVG ergibt sich ein allgemeines Beratungsrecht.
Arbeitgeber und Betriebsrat sollen mindestens einmal im Monat zu einer Besprechung zusammentreten.
Dort sollen strittige Fragen, Vorschläge und Meinungsverschiedenheiten diskutiert werden.
Widerspruchsrecht
Ein weiteres Beteiligungsrecht ist das Widerspruchsrecht des Betriebsrats. Durch den Widerspruch kann der Betriebsrat ausdrücken, dass er mit der Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden ist.
Der wichtigste Fall ist die Ausübung des Widerspruchsrechts bei der ordentlichen Kündigung, § 102 Abs. 3 BetrVG. Der Widerspruch hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit der Kündigung. Allerdings begründet der Widerspruch des Betriebsrats gem. § 102 Abs. 5 BetrVG einen Anspruch des Arbeitnehmers auf vorübergehende Weiterbeschäftigung.
Zustimmungsverweigerungsrecht
Das Zustimmungsverweigerungsrecht ist in § 99 Abs. 2 BetrVG in Bezug auf die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen enthalten. Der Betriebsrat kann die Zustimmung beispielsweise verweigern, wenn:
[…] der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt ist (§ 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG).
Die Rechtsfolge der Zustimmungsverweigerung ist, dass der Arbeitgeber die Maßnahme nicht durchsetzen darf, § 99 Abs. 4 BetrVG. Die Einflussnahme durch das Zustimmungsverweigerungsrecht ist daher größer, als bei dem Widerspruchsrecht.
Mitbestimmungsrecht
Die sogenannten „echten“ Mitbestimmungsrechte sind erzwingbar und die Beteiligung des Betriebsrats ist notwendigerweise erforderlich.
Wenn der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht innehat, ist er gleichberechtigt an Entscheidungen des Arbeitgebers beteiligt, weil die Zustimmung des Betriebsrats zwingend erforderlich ist.
Erteilt der Betriebsrat die Zustimmung nicht, kann diese nur durch einen Beschluss der Einigungsstelle ersetzt werden. Diese Mitbestimmungsrechte sehen unter anderem die §§ 87 Abs. 2, 76 Abs. 5, 77 Abs. 6 BetrVG vor.
Der Arbeitgeber, der ein Unternehmen mit Betriebsrat betreibt, möchte die betriebsüblichen Arbeitszeiten vorübergehend verkürzen, um Geld einzusparen. Diese Entscheidung bespricht er nicht mit dem Betriebsrat.
Bei der Entscheidung darüber, ob die betriebsüblichen Arbeitszeiten verkürzt werden, hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht, § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG. Dass der Arbeitgeber sich über die Angelegenheit nicht mit dem Betriebsrat geeinigt hat, hat gem. § 87 Abs. 2 S. 1 BetrVG die Folge, dass die Einigungsstelle entscheidet.
Betriebsverfassungsgesetz Kündigung
Das Betriebsverfassungsgesetz sieht zum einen in §§ 102 und 103 BetrVG eine Mitwirkung des Betriebsrats an der Kündigung eines Arbeitnehmers vor. Zum anderen gilt gem. § 15 KSchG ein besonderes Kündigungsrecht für die Mitglieder des Betriebsrats.
Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht über die Entscheidung zur Kündigung eines Arbeitnehmers.
Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören.
Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen.
Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam (§ 102 Abs. 1 BetrVG).
Hat der Betriebsrat gegen eine Kündigung Bedenken, kann er diese schriftlich mitteilen. Bei einer ordentlichen Kündigung beträgt die Frist eine Woche (§ 102 Abs. 2 S. 1 BetrVG), bei einer außerordentlichen Kündigung beträgt sie drei Tage (§ 102 Abs. 2 S. 3 BetrVG).
Möchte der Betriebsrat der geplanten ordentlichen Kündigung nicht zustimmen, kann er innerhalb der Frist von einer Woche schriftlich Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist zu begründen. Wenn der Betriebsrat sich innerhalb der Frist von einer Woche nicht äußert, gilt die Zustimmung zur Kündigung erteilt, § 102 Abs. 2 S. 2 BetrVG. Mögliche Gründe für einen Widerspruch gegen die Kündigung sind in § 102 Abs. 3 BetrVG genannt. Diese sind:
- die nicht oder nicht ausreichende Berücksichtigung der sozialen Gesichtspunkte des zu kündigenden Arbeitnehmers
- der Verstoß der Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95
- die Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers an einem anderen Arbeitsplatz im selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens
- die Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen
- die Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertragsbedingungen
Der Arbeitgeber ist jedoch nicht an den Widerspruch des Betriebsrats gebunden. Er kann die Kündigung trotz des Widerspruchs aussprechen.
Bei außerordentlichen Kündigungen hat der Betriebsrat kein Recht Widerspruch zu erheben, sondern kann lediglich Bedenken äußern, § 103 BetrVG.
Wenn Du mehr über die ordentliche oder außerordentliche Kündigung erfahren möchtest, kannst Du Dir die Erklärungen Kündigungsarten und Kündigungsgründe anschauen.
Für die Kündigung eines Betriebsratsmitglieds ist ein besonderer Kündigungsschutz vorgesehen. Der Grund dafür ist, dass die Mitglieder des Betriebsrats die Interessen der Arbeitnehmer*innen vertreten und diese vor dem Arbeitgeber deutlich machen und durchsetzen müssen. Dadurch kann es im Zweifelsfall zu Konflikten mit dem Arbeitgeber kommen.
Damit dieser sein Kündigungsrecht nicht gegen die Mitglieder des Betriebsrats verwendet, kommt ihnen ein besonderer Kündigungsschutz zu. Ein Betriebsratsmitglied, das bei der Durchsetzung der Interessen der Arbeitnehmer*innen Angst vor einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses haben muss, kann die Interessen weniger effektiv durchsetzen. Deshalb ist ein besonderer Kündigungsschutz notwendig.
Der besondere Kündigungsschutz der Mitglieder des Betriebsrats ist in § 15 KSchG geregelt. Gem. § 15 Abs. 1 KSchG ist eine Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats unzulässig, außer diese Voraussetzungen vorliegen:
- es sind Tatsachen gegeben, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen
- es ist die nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes erforderliche Zustimmung vorliegend oder sie wird durch gerichtliche Entscheidung ersetzt
Eine ordentliche Kündigung eines Betriebsratsmitglieds ist also grundsätzlich unzulässig. Eine außerordentliche Kündigung aus einem wichtigen Grund ist weiterhin möglich. Allerdings muss zusätzlich der Betriebsrat oder das Gericht einer solchen Kündigung zustimmen.
Der besondere Kündigungsschutz gilt gem. § 15 Abs. 3 S. 1 KSchG bereits für Bewerber*innen auf eine Mitgliedschaft im Betriebsrat. Er besteht für die Dauer von einem Jahr nach Ausscheiden aus dem Betriebsrat fort, § 15 Abs. 1 S. 2 KSchG.
Jana ist Mitglied des Betriebsrats und Hanna, ihre Arbeitgeberin, möchte das Arbeitsverhältnis mit ihr kündigen. Welche Voraussetzungen müssen dazu vorliegen?
Eine ordentliche Kündigung ist unzulässig. Daher bleibt die außerordentliche Kündigung, die das Vorliegen eines wichtigen Grundes voraussetzt, der das Fortführen des Arbeitsverhältnisses unzumutbar macht. Daneben ist die Zustimmung des Betriebsrats nach § 103 BetrVG erforderlich oder es muss gerichtlich entschieden worden sein, dass die außerordentliche Kündigung zulässig ist.
Betriebsverfassungsgesetz Betriebsversammlung
Die Vorschriften zu der Betriebsversammlung findest Du in den §§ 42 bis 46 BetrVG. In § 42 Abs. 1 S. 1 BetrVG wird definiert, was unter einer Betriebsversammlung zu verstehen ist.
Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitnehmern des Betriebs; sie wird von dem Vorsitzenden des Betriebsrats geleitet.
In der Betriebsversammlung treffen sich die Arbeitnehmer*innen mit dem Betriebsrat, um sich über Probleme oder aktuelle Themen auszutauschen. Welche Themen bei einer Betriebsversammlung besprochen werden können, ist in § 45 S. 1 BetrVG festgehalten:
Die Betriebs- und Abteilungsversammlungen können Angelegenheiten einschließlich solcher tarifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer und wirtschaftlicher Art sowie Fragen der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie der Integration der im Betrieb beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer behandeln, die den Betrieb oder seine Arbeitnehmer unmittelbar betreffen […].
Die Betriebsversammlung findet gem. § 43 Abs. 1 BetrVG einmal in jedem Kalendervierteljahr durch die Einberufung des Betriebsrats statt. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch weitere Betriebsversammlungen abgehalten werden.
Insgesamt bietet die Betriebsversammlung eine Gelegenheit, sich zu den aktuellen Themen im Betrieb zu äußern. Dazu räumt der Betriebsrat in der von ihm bestimmten Tagesordnung ausreichend Zeit ein.
Betriebsverfassungsgesetz JAV
Was Du Dir unter der Jugend- und Auszubildendenvertretung, die mit JAV abgekürzt werden kann, vorstellen kannst, erfährst Du in den §§ 60 bis 73b BetrVG.
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen der Jugendlichen und jungen Auszubildenden eines Betriebes, in dem ein Betriebsrat besteht.
Durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung werden die besonderen Belange der jungen Arbeitnehmer*innen sichtbar gemacht. In § 60 Abs. 1 BetrVG ist festgehalten, wann eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt werden muss:
In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.
Sobald in dem Betrieb ein Betriebsrat besteht und mindestens fünf junge Arbeitnehmer*innen beschäftigt werden, muss eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt werden. Wahlberechtigt sind alle jugendlichen Arbeitnehmer*innen (unter 18 Jahren) und die Auszubildenden, die ihr 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, § 61 Abs. 1 BetrVG. Gewählt werden können die Arbeitnehmer*innen, die unter 25 Jahren alt sind und nicht Mitglieder des Betriebsrats sind, § 61 Abs. 2 BetrVG.
Zwischen dem Betriebsrat und der Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht eine enge Zusammenarbeit, um zu gewährleisten, dass die Belange des JAV dem Betriebsrat bekannt sind und von ihm umgesetzt werden können.
Um die Interessen der jungen Arbeitnehmer*innen besser vertreten zu können, kann vor oder nach jeder Betriebsversammlung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung einberufen werden, § 71 S. 1 BetrVG.
Betriebsverfassungsgesetz – Das Wichtigste
- Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ermöglicht, dass die Arbeitnehmer*innen den Ablauf und die Regelungen im Betrieb aktiv mitbestimmen können.Es wird dem Kollektivarbeitsrecht zugeordnet.
- Das Kollektivarbeitsrecht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgeber*innen sowie zwischen den Betriebsräten und Arbeitgeber*innen.
- Das Betriebsverfassungsgesetz regelt die innerbetriebliche Ordnung und die Mitbestimmung von Arbeitnehmer*innen im Betrieb. Gegenüber dem Arbeitgeber werden die Arbeitnehmer*innen durch den Betriebsrat vertreten.
- Die Arbeitnehmer*innen sollen an den Entscheidungen des Arbeitgebers teilhaben können.
- Es muss ein Betrieb mit mindestens fünf Arbeitnehmer*innen vorliegen. Ein Betrieb ist eine organisatorische Einheit, innerhalb derer Arbeitgeber mit Arbeitnehmern bestimmte arbeitstechnische Ziele verfolgen und dazu Wirtschaftsgüter produziert oder Dienstleistungen erbracht werden.
- Der Betriebsrat ist ein Zusammenschluss von Arbeitnehmer*innen, der die Arbeitnehmerinteressen in einem Betrieb gegenüber dem Arbeitgeber vertritt.
- Ein Mitglied des Betriebsrats ist ein von Arbeitnehmer*innen eines Betriebes gewählter Vertreter, der ihre Interessen wahrnehmen soll und sie vor dem Arbeitgeber repräsentiert.
- Allgemein ist der Betriebsrat dafür verantwortlich, die Interessen und Rechte der Arbeitnehmer*innen gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten.
- Der Betriebsrat hat Unterrichtungs-, Anhörungs-, Beratungs-, Widerspruchs-, Zustimmungsverweigerungs- und echte Mitbestimmungsrechte.
Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitnehmer*innen des Betriebes und wird von dem Vorsitzenden des Betriebsrats geleitet.
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen der Jugendlichen und jungen Auszubildenden eines Betriebes, in dem ein Betriebsrat besteht.
Nachweise
- Düwell, Franz Josef (2022). Betriebsverfassungsgesetz. BetrVG, WO, EBRG, SEBG. Handkommentar. Nomos Verlagsgesellschaft. 6. Auflage.
- Richardi, Reinhard/Thüsing, Gregor/Annuß, Georg/Maschmann, Frank/Picker, Christian/Forst, Gerrit (2022). Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung. Verlag C.H. Beck oHG. 17. Auflage.
- Junker, Abbo (2022). Grundkurs Arbeitsrecht. Verlag C.H. Beck oHG. 21. Auflage.
- Waltermann, Raimund (2021). Arbeitsrecht. Verlag Franz Vahlen. 20. Auflage.
Lerne schneller mit den 17 Karteikarten zu Betriebsverfassungsgesetz
Melde dich kostenlos an, um Zugriff auf all unsere Karteikarten zu erhalten.
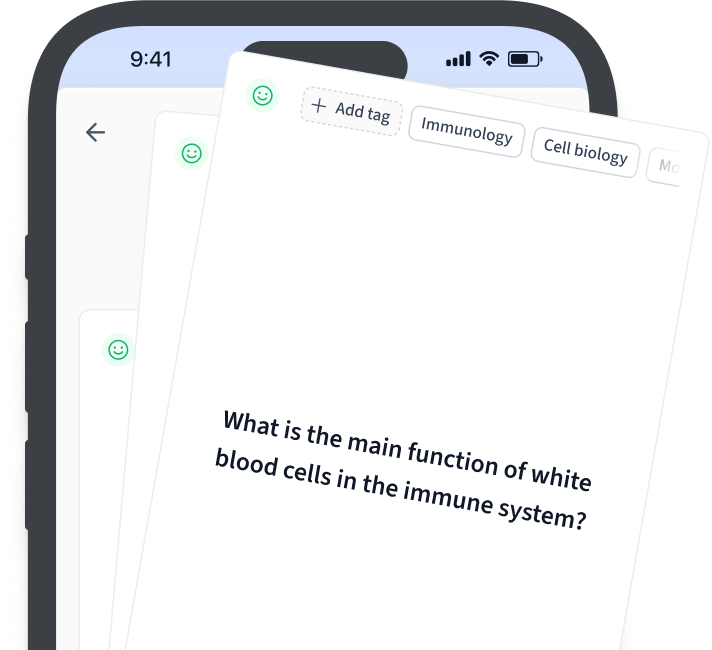
Häufig gestellte Fragen zum Thema Betriebsverfassungsgesetz
Was wird im Betriebsverfassungsgesetz geregelt?
Im Betriebsverfassungsgesetz wird die innerbetriebliche Ordnung und die Mitbestimmung von Arbeitnehmer*innen im Betrieb geregelt. Gegenüber dem Arbeitgeber werden die Arbeitnehmer*innen durch den Betriebsrat vertreten.
Wann wurde das Betriebsverfassungsgesetz eingeführt?
Das Betriebsverfassungsgesetz ist erstmals am 14.11.1952 in Kraft getreten.
Für wen gilt das Betriebsverfassungsgesetz?
Das Betriebsverfassungsgesetz gilt für Betriebe, die über fünf Arbeitnehmer*innen beschäftigt.
Welche Ziele verfolgt das Betriebsverfassungsgesetz?
Das Betriebsverfassungsgesetz verfolgt die Ziele, dass die Arbeitnehmer*innen die Möglichkeit haben an der Organisation des Betriebs teilzuhaben und ihre Interessen geltend zu machen.


Über StudySmarter
StudySmarter ist ein weltweit anerkanntes Bildungstechnologie-Unternehmen, das eine ganzheitliche Lernplattform für Schüler und Studenten aller Altersstufen und Bildungsniveaus bietet. Unsere Plattform unterstützt das Lernen in einer breiten Palette von Fächern, einschließlich MINT, Sozialwissenschaften und Sprachen, und hilft den Schülern auch, weltweit verschiedene Tests und Prüfungen wie GCSE, A Level, SAT, ACT, Abitur und mehr erfolgreich zu meistern. Wir bieten eine umfangreiche Bibliothek von Lernmaterialien, einschließlich interaktiver Karteikarten, umfassender Lehrbuchlösungen und detaillierter Erklärungen. Die fortschrittliche Technologie und Werkzeuge, die wir zur Verfügung stellen, helfen Schülern, ihre eigenen Lernmaterialien zu erstellen. Die Inhalte von StudySmarter sind nicht nur von Experten geprüft, sondern werden auch regelmäßig aktualisiert, um Genauigkeit und Relevanz zu gewährleisten.
Erfahre mehr

